Leserbriefe zum Special „Welternährung“ in Heft 7/2019
- 11.09.2019
- Print-News
- Birgit Hinsch
- Friedrich Schöne
„Endlich!“
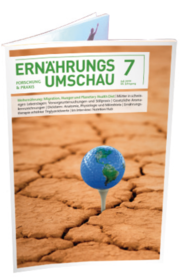
„Endlich“ ist das Wort, das mir beim kurzem Anlesen der Ausgabe 7 ERNÄHRUNGS UMSCHAU durch den Kopf geistert […]. Besten Dank für das Aufgreifen der Planet Health Diet und den Platz, den Sie dem Thema einräumen. Welternährung ist wichtiger und dringender denn je!“
Birgit Hinsch
Redakteurin Öko-Test, Frankfurt
Planetare Belastungsgrenzen wichtiges Kriterium für das Nahrungssystem
Zur Kurzfassung des EAT Lancet Reports über „Healthy diets from sustainable food systems – Gesunde Ernährung aus nachhaltiger Nahrungsbereitstellung“ in Heft 7 der ERNÄHRUNGS UMSCHAU, S. M408–M424 möchte ich als langjähriger Verantwortlicher für das Modul „Food Safety and Quality Chains“ des postgradualen Studienganges „Environmental Protection and Agricultural Food Production – EnviroFood“ an der Universität Hohenheim einige Anmerkungen ergänzen.
Bedeutung des Graslands berücksichtigen
Die aufgezeigten globalen Grenzen für den Umfang nutzbaren Ackerlandes, der Wasservorräte für die Bewässerung, des Stickstoff- sowie Phosphateintrags und eines ökologisch „verkraftbaren“ Biodiversitäts- sprich Artenverlustes sind nachvollziehbar. Das betrifft ebenfalls den agrarischen Treibhausgasausstoß, der von derzeit jährlich 5 Mrd. t CO2-Äqivalenten bis zur CO2-Neutralität dekarbonisiert werden soll.
In dem Zusammenhang sei an die Photosynthese-Leistung der Agrarflächen, also an die Bildung von Kohlenstoffverbindungen durch die Nutzpflanzen, erinnert. Als CO2-Senke fungiert aber nicht nur das Ackerland im zitierten Umfang von 13 Mio. km2, sondern ebenfalls das in dem Bericht weitgehend negierte Grasland, mit 33 Mio. km2. Wiesen und Weiden bedeuten Rinder, Schafe, Ziegen und weitere Wiederkäuer für Milch und Fleisch, aber auch Ausstoß v. a. des klimarelevanten Methans. Hier ist ein wirtschaftlicher und umweltverträglicher Viehbesatz im Verhältnis zum Pflanzenaufwuchs das Credo. Umweltverträglich meint den Schutz der indigenen Fauna und Flora, eingeschlossen ein Gleichgewicht zwischen CO2-Verbrauch des Graslands und Freisetzung von Gasen mit Klimarelevanz durch Weidetiere. […]
Planetary Health Diet
Die Notwendigkeit einer Umstellung der an gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz reichen Western Diet zu Lasten vom Tier stammender Lebensmittel, besonders von Fleisch/-erzeugnissen und zugunsten pflanzlicher Lebensmittel, steht außer Frage, sowohl für unsere Gesundheit als auch für die Einhaltung/ Unterschreitung genannter „Planetarer Belastungsgrenzen“. […]
Ein Rückgang in der Aufnahme von Fleisch, Milch und Eiern würde für die höhere Zahl von zukünftig zu ernährenden Menschen weniger Futterfläche und mehr Feldfrüchte für den Direktkonsum bedeuten. Dabei ist in der Planetary Health Diet das Ausmaß der Reduzierung besonders beim Fleisch auf im Tagesdurchschnitt 43 g (0–86 g/Tag) einschneidend. Tatsächlich würde die Verminderung für das Fleisch hierzulande zwei Drittel (Bezugsbasis 43 kg/Kopf und Jahr, NVS I, 2006) bis drei Viertel (Bezugsbasis 59 kg/ Kopf und Jahr, Stat. Jahrbuch BMELF, 2017) betragen. Für rotes Fleisch ist die Diskrepanz noch höher […]. Das global zugestandene Mittel von insgesamt 43 g Fleisch/-erzeugnissen/Tag entspricht dem unteren Wert der wöchentlich 300–600 g/Woche in den DGE-Empfehlungen. […].
Transformation oder Transition?
Anstelle der von der Kommission mehrfach beschworenen Great Transformation (der Ernährungsweise) wäre aus meiner Sicht der Begriff „Übergang“ (engl.: transition) vorzuziehen. Great Transformation impliziert Zwang und Gesetze, von denen Wohlfahrtssysteme auf Basis freiheitlicher sozialer Marktwirtschaft nicht ein Zuviel vertragen. In dem Zusammenhang können auch nicht China und Vietnam mit ihren totalitären Regimes als Beispiele für gelungene Transformationen herhalten ([1] S. M419), zumal gerade dort in kurzer Zeit Produktion und Konsum von Fleisch drastisch angestiegen sind. […]
=> Ausführlicher Leserbrief inkl. Literaturangaben in Online PLUS
Prof. Dr. agr. habil. Friedrich Schöne
Jena
friedrich.schoene@uni-jena.de
Gerne drucken wir Ihre Zuschriften ab. Bitte formulieren Sie sachlich und kurz (max. 3 000 Zeichen), adressieren einen konkreten inhaltlichen Aspekt und belegen Ihre Aussagen mit maximal drei Literaturstellen.
Diese Artikel finden Sie auch in ERNÄHRUNGS UMSCHAU 9/2019 auf Seite M513.
