Ernährungsbildung: 2. BZfE-Forum - „Ich kann. Ich will. Ich werde!“
- 13.12.2018
- Print-News
- Dr. Sabine Schmidt
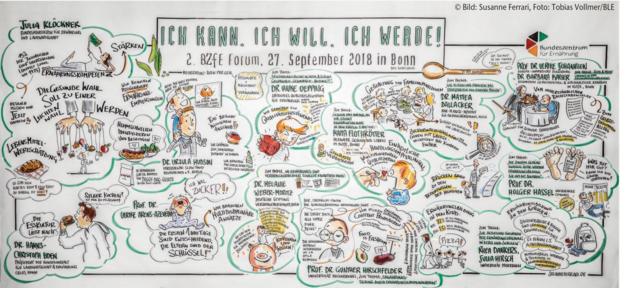
Die rund 400 TagungsteilnehmerInnen reagierten positiv auf das Statement der Ministerin, die die Einbeziehung von Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Ernährung als eigenen Haushaltstitel im Bundeshaushalt 2019 ankündigte. Daneben warb sie für die beiden aktuellen Schwerpunkte ihres Ministeriums: Die „ersten 1 000 Tage“ sowie ihre „Initiative für Senioren“. In Anlehnung an die laut Klöckner erfolgreich arbeitenden Vernetzungsstellen Schulverpflegung1 ist es eins ihrer Ziele, Vernetzungsstellen zur Seniorenverpflegung einzurichten.
Junge Familien bis SeniorInnen
Beide von Klöckner genannten Schwerpunktthemen – junge Familien sowie SeniorInnen – wurden auch im weiteren Tagungsverlauf in Bezug auf die Ernährungsbildung genauer ausgeführt. Maria Flothkötter vom „Netzwerk Gesund ins Leben“ stellte das Bildungs- und Kommunikationskonzept des Netzwerks für „die ersten 1 000 Tage“ vor. Die neuen Leitlinien für Frauen mit Kinderwunsch waren bereits am Vortag in einem Journalistenworkshop präsentiert worden.2
Den Fokus auf ältere Menschen legte Prof. Holger Hassel von der HAW Coburg: „Seniorinnen und Senioren fällt es oft schwer, vertrauenswürdige Ernährungsinformationen zu finden und diese bei ihren alltäglichen Gewohnheiten (…) umzusetzen“, erläuterte er. Studien zeigten jedoch, wie gut sich die Ernährungskompetenz auch noch in fortgeschrittenem Alter fördern ließe. Dabei seien soziale Kontakte und die Berücksichtigung individueller Essbiografien wesentliche Motoren.
Zielgruppengerechter digitaler Content
Inspirierendes und Stoff zum Nachdenken lieferte Prof. Gunter Hirschfelder in seinem aufschlussreichen Vortrag „(K)ein Leitfaden zur Ernährungsbildung durch Ernährungskommunikation“. Einen solchen lieferte er dann auch (nicht), wies die ZuhörerInnen jedoch auf die entscheidenden Herausforderungen des digitalen Zeitalters im Hinblick auf die Ernährungskommunikation hin: Früher seien Informationen durch verschiedene Filter gelaufen, bis sie VerbraucherInnen erreichten, z. B. die universitäre Forschung, Peer-Review-Verfahren oder auch die Redaktionen öffentlich-rechtlicher Fernsehsender.
Heute flössen die gerade von Jugendlichen am meisten aufgenommenen Infos direkt online, z. B. Ernährungstipps von You-Tube-Stars oder Ernährungsdokus in Streaming-Portalen wie Netflix. Die digitale Revolution habe „die alte Bildungswelt zum Einsturz gebracht“, die „Deutungshoheit“ über Inhalte habe sich „disruptiv verschoben“, hob er hervor. Die digitale Kommunikation, in der sich junge Menschen selbstverständlich bewegten, sei für (ältere) ExpertInnen „ein Informationskosmos, für den wir keinen Fahrplan haben“.
Die Lösung? Kenne er auch nicht, untertrieb er, um sogleich einige Anregungen für kommunikatives Handeln durch den „verunsicherten Experten“ in den Raum zu stellen: ExpertInnen müssten sich dringend mit den Kommunikationsformen der Jugendlichen beschäftigen und ihre Bedürfnisse analysieren. Auf dieser Basis könnten sie „behutsam andocken“ an die modernen Kommunikationsformen und vielleicht irgendwann auch zielgruppengerechten Content produzieren. Eins schien ihm sicher: „Die Zeit der Schautafeln und Ernährungskreise ist vorbei.“
Institutionelle Ernährungsbildung
Nach diesen Bottom-Up-Gedanken dazu, wie sich Erwachsene in den Informationsbedarf Jugendlicher eindenken müssen, stellten Rhea Dankers und Julia Hirsch (Universität Paderborn) die Rahmenlehrpläne in der „Top-Down“ geplanten institutionellen Ernährungsbildung in Kitas und Schulen vor. Das Ergebnis: Sowohl ErzieherInnen als auch LehrerInnen haben Ausbildungslücken im Bereich Ernährung und daher Fortbildungsbedarf.
Die Analyse von ernährungsbezogenen Inhalten der Rahmenlehrpläne und Curricula zeigte insbesondere zwei Dinge: Die Inhalte sind erstens oft unspezifisch und zweitens in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Dass Kinder in verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedliche Dinge zur Ernährung lernen, ist eine Tatsache, die sich der Ernährungsfachkraft logisch nicht erschließt und nicht nur die Ernährung, sondern viele Herausforderungen der modernen Welt betreffen dürfte.
Die Verpflegung in Schulen und Kitas ist vielleicht schon auf einem besseren Weg, da sie mit dem von seiner Leiterin Dr. Anke Oepping vorgestellten „Nationalen Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und Schule“ seit 2017 eine eigene Lobby-Institution direkt in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hat. Oepping wies auf den noch eher neuen und wichtigen Ansatz ihrer Institution hin, die Qualität der Verpflegung nicht nur im Produkt – den Speisen –, sondern auch im Erleben der Mahlzeit zu sehen, und betonte, dass Kinder immer lernen würden, nicht nur „im Stuhlkreis“, d. h. bei formalen Lernaktivitäten.
Familienmahlzeiten prägen Essverhalten
Das Alltagslernen beim Essen griff auch Dr. Mattea Dallacker (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung) noch einmal auf, die eine Metastudie zur Analyse von Familienmahlzeiten vorstellte. Ein 10-jähriges Kind hat in seinem Leben schon ca. 10 000 Mahlzeiten zu sich genommen, die dadurch erhebliche Auswirkungen auf sein erlerntes Essverhalten haben. Je häufiger Familien gemeinsam essen, desto höher ist der Studie nach der Konsum von Obst und Gemüse und desto niedriger der von Snacks und Soft Drinks. Dallacker stellte sechs aus Mahlzeitenstudien gewonnene, für die Ernährungsbildung sehr hilfreiche „protektive Mahlzeitenroutinen“ vor, darunter eine längere Mahlzeitendauer, eine positive Atmosphäre und Eltern als Vorbilder.
Fazit: Ernährungskommunikation muss neu gedacht werden
Nachdem alle Lebensphasen der Ernährungsbildung im Tagesverlauf „abgearbeitet“ waren, resümierte Dr. Margareta Büning-Fesel, Leiterin des BZfE, mit einer verheißungsvollen Andeutung: Zusammen mit der DGE werde daran gearbeitet, wie Ernährungsempfehlungen für VerbraucherInnen einfacher werden könnten, denn „schließlich essen wir nicht von Ernährungspyramiden“. „Ernährungskommunikation muss neu gedacht werden“ war ein Schlusswort, dem sicher alle zustimmen konnten.
_______
1 Anm.: deren Finanzierung der Bund 2017 bis auf Einzelprojektförderungen an die Länderministerien delegiert hat
2 => „Neue nationale Empfehlungen für Frauen mit Kinderwunsch“, Online-Meldung der ERNÄHRUNGS UMSCHAU vom 28.09.2018
BZfE Bildungsnews
Zweimal im Jahr gibt das BZfE seit 2017 „Bildungsnews“ heraus. Vorgestellt werden neue Themen und Materialien, Anregungen für die Schul- und Kitaverpflegung sowie Trends und Entwicklungen in der Ernährungs- und Verbraucherbildung.
-> www.bzfe.de/inhalt/bildungsnews-30114.html
Diesen Artikel finden Sie auch in Ernährungs Umschau 12/2018 von Seite M666 bis M667.
